Inhalt
Bericht vom DPMAnutzerforum 2025

Podiumsdiskussion zum Digital Services Act
„Gefährliche“ KI, „zahnloser“ DSA, „abgehängtes“ Deutschland?
In Zeiten, in denen vieles ungewiss und unsicher geworden zu sein scheint, tut es gut, wenn man sich auf bestimmte Dinge noch verlassen kann. Etwa darauf, dass das DPMAnutzerforum jedes Jahr einen spannenden Austausch zu aktuellen Themen rund um geistiges Eigentum und gewerblichen Rechtsschutz bietet.
Zur Eröffnung hatte DPMA-Präsidentin Eva Schewior eine gute Nachricht für die Gäste: Aller konjunkturellen Schwäche zum Trotz haben deutsche Unternehmen 2024 ganze 4 Prozent mehr Erfindungen angemeldet als noch im vergangenen Jahr. „Dass die Innovationstätigkeit deutscher Unternehmen merklich angezogen hat, ist ein gutes Zeichen und zeigt, dass sie trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage stark in Forschung und Entwicklung investieren und auf den Schutz ihrer Innovationen setzen.“
Aus dem Ausland gingen dagegen fast 5 Prozent weniger Anmeldungen für den deutschen Markt ein. Insgesamt wurden 59.260 Erfindungen beim DPMA zum Patent angemeldet – ein leichtes Plus von 1,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
„Unsere Prüferinnen und Prüfer waren im Jahr 2024 sehr leistungsfähig für Sie“, berichtete Schewior weiter: Sie schlossen 45.242 Patentprüfungsverfahren ab (das sind 6 Prozent mehr als 2023) und gewährten für 23.944 Erfindungen Schutz - ein deutliches Plus von 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In 21.298 Fällen wurde kein Patent erteilt, weil die Prüferinnen und Prüfer die Anmeldung zurückwiesen, die Anmelder sie zurücknahmen oder fällige Gebühren nicht gezahlt wurden. Die Erteilungsquote lag damit bei 52,9 Prozent.
Schöne Überraschung bei angemeldeten Designs
Auch bei den Marken konnte das DPMA 2024 steigende Anmeldezahlen verzeichnen: 80.365 nationale und internationale Marken wurden im vergangenen Jahr neu angemeldet - 2,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Als „kleine Überraschung“ wertet Schewior, dass die Designanmeldungen Zahl der Designs erstmals seit Langem wieder zulegten. Fast 30.000 Anmeldungen angemeldete Designs gingen 2024 ein und damit 2,4 Prozent mehr als im Vorjahr.
Nicht ganz so positiv sieht es beim Gebrauchsmuster aus: Hier beobachtete das DPMA 2024 eine leicht rückläufige Entwicklung. Insgesamt 9.577 Anmeldungen gingen beim DPMA ein, 1,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Vor allem die Anmeldezahlen aus dem Inland gingen hierbei zurück (-5,1%).
Schewior ging in ihrer Rede ansonsten nicht ausführlich auf die Jahresstatistik des DPMA ein, die bereits in einer Pressemitteilung und auf den Statistik-Seiten veröffentlicht wurde. Sie richtete den Fokus auf eine aktuelle Sonderauswertung aus dem „Datenschatz“ des Amtes, nämlich zu Patentanmeldungen im Bereich der Digitalisierung: „Ein Thema, das nicht mehr wegzudenken ist, wenn es um unser Wirtschaftswachstum und den Wohlstand unserer Gesellschaft geht.“
Das war das DPMAnutzerforum 2025 - Neues aus dem DPMA - IP-News
Deutschland fällt zurück
Mit der digitalen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft tue Deutschland sich schwerer als andere Länder, so Schewior. Das sei ein Befund der Expertenkommission Forschung und Innovation der Bundesregierung – und das zeige auch in aller Deutlichkeit der jüngste Global Innovation Index der WIPO. „Diese Studie bescheinigt uns aber zugleich, dass wir hier in Deutschland derzeit noch über ein starkes und sehr effektives Innovationssystem verfügen.“
Schewior präsentierte eine Auswertung der Entwicklung von Patentanmeldungen aus den fünf für die Digitalisierung wichtigsten Technologiefeldern: Computertechnik, digitale Kommunikationstechnik, audiovisuelle Technik, das Technologiefeld Halbleiter sowie Datenverarbeitungsverfahren für betriebswirtschaftliche Zwecke. Die Auswertung zeigt, dass Deutschland in vier Technologiefeldern Plätze einbüßte. Alle fünf Technologiefelder zusammengenommen liegt Deutschland bezüglich seiner Patentanmeldungen auf Platz 5. Die Vereinigten Staaten dagegen konnten ihre Position in allen Technologiefeldern halten, während China und Korea eine rasante Aufholjagd hinlegten.
„Wir sind also insgesamt im Bereich Digitalisierung im Vergleich zu 2020 um einen Rang zurückgefallen“, bedauerte Schewior. „Und darin liegt sicherlich eine erhebliche Gefahr. Denn wenn wir hier den Anschluss verlieren, wird unsere Innovationskraft in allen Branchen leiden“, so Schewior.
Lichtblick: Trendwende in Sicht?
Zahlen und Präsentationen
Alle Zahlen und Statistiken sowie die Präsentationen zu vielen Vorträgen des diesjährigen DPMAnutzerforums finden Sie in den Unterlagen.
Aber es gibt Hoffnung – und zwar in der jüngsten Entwicklung, so Schewior: „Wir stellen nämlich fest, dass Deutschland im vergangenen Jahr aufgeholt hat. 2024 haben deutsche Unternehmen 6,6 Prozent mehr Erfindungen aus dem Bereich Digitalisierung angemeldet als im Vorjahr.“ Die steigenden Zahlen fußen auf einem deutlichen Zuwachs bei Halbleitern, bei Datenverarbeitungsverfahren, aber auch in der Computertechnik (siehe dazu die Pressemitteilung vom 24.3.2025).
„Unser Land hat mit seinen starken Technologieunternehmen, hervorragenden Hochschulen und talentierten Köpfen alle Voraussetzungen, um auch bei den Digitaltechnologien eine führende Rolle zu spielen. Dieses Potenzial müssen wir aber noch besser in geschützte Innovationen und dann in attraktive Produkte und Geschäftsmodelle umsetzen. Dafür gilt es jetzt, die optimalen Rahmenbedingungen zu schaffen“, so Schewior. Dann könne der Wirtschaftsstandort Deutschland erfolgreich bleiben und seine internationale Wettbewerbsfähigkeit behaupten.
SPRIND: Disruptiv denken!
Dr. Antonia Schmalz präsentierte in der Keynote die „Bundesagentur für Sprunginnovationen“, kurz SPRIND. Die 2019 gegründete Agentur sieht sich als „Heimat für radikale Neudenker:Innen“ und fördert Ideen, „die das Potential haben, unser Leben von Grund auf zu verbessern“. Unter Sprunginnovation versteht sie eine „disruptive“ (oder auf Englisch „break through“) Innovation, die eine Antwort auf „tiefgreifende Fragen“ und das Potential hat, „die Gesellschaft zu verändern“.
Eines der Ziele von SPRIND ist es, bei der Entstehung von neuen Unternehmen das „Tal des Todes“ finanziell zu überbrücken, also das Loch zwischen dem erfolgreichen Abschluss eines Forschungs- oder Erfindungsprojektes und dem Einsetzen des Kapitalflusses durch Investoren.
Aber es geht ihr nicht allein um Fragen der Finanzierung, sondern auch um den Aufbau des geeigneten „mindsets“. Die Agentur will Unternehmergeist und eine gewisse Bereitschaft zum Risiko im Lande fördern. Die Vernetzung von Forschung und Wirtschaft ist daher eine zentrale Aufgabe von SPRIND. Sie hilft bei „der Inkubation von Projekten und Teams“, unterstützt beim IP-Transfer und wirbt für die Beschleunigung von rechtlichem Rahmenwerk, so Schmalz.
200 Millionen Euro Budget hat SPRIND insgesamt. Damit gründet sie eigene Tochtergesellschaften, investiert Kapital, beschafft Darlehen, vermittelt und stellt „Challenges“. Zu den Projekten, an denen die Agentur direkt oder indirekt beteiligt ist, gehören beispielsweise hoffnungsvolle junge Unternehmen aus den Bereichen Windkraft, Kernfusion, virenfangende „DNA-Origami“ oder CO2-neutraler Beton, die ihrerseits zahlreiche neue Ausgründungen hervorgebracht haben.
Gute KI, böse KI?
Als nächstes stand die beliebte Expertendebatte auf dem Programm. Moderator Ulrich Walter unterhielt sich mit zwei Wirtschaftsvertretern über das Thema "Künstliche Intelligenz – Chancen und Risiken für Innovationen und den gewerblichen Rechtsschutz".
Stefan Brehm arbeitet für die Predori GmbH, die ein KI-Tool für die Patentrecherche und -monitoring entwickelt hat. Daher sieht er im Einsatz von KI „wahnsinnige Chancen“, wenn die Instrumente „seriös“ und datenbankbasiert den Menschen bei seiner Arbeit unterstützen. Im Gegensatz dazu neigten manche KI-Sprachmodelle bekanntlich zum „Fabulieren“ und erfänden fatalerweise mitunter sogar Patentnummern. Insgesamt werde KI zwar immer schlauer, sei aber noch lange keine „harte KI“, so Brehm. Es gelte: „Der Mensch muss Entscheider bleiben!“
Die Cyber Valley GmbH, bei der Paul-David Bittner arbeitet, versteht sich als „Hub“ für KI, Politik und Wirtschaft, der Investoren und Start-ups zusammenbringt und besonders die Frühphasenförderung im Visier hat. Die Risiken, die manche beim Einsatz von KI befürchten, hält Bittner für eher übertrieben oder „nicht real“. KI sei ja „noch nicht mal so schlau wie eine Hauskatze“. Wenn sie dem Menschen als persönlicher Assistent diene, sei sie sehr wertvoll. Eine echte Gefahr sah Bittner aber im Zusammenhang mit der massenhaften Meinungsbeeinflussung in den sozialen Medien; Fake News seien heute schwerer denn je zu entlarven.
Aber geben wir nicht längst schon zu viel von unseren ureigenen Aufgaben und Fähigkeiten an KI ab? Die Frage des Moderators Walter traf insofern ins Schwarze, als die Experten einräumten, ohne ihr Navigationssystem den Weg ins DPMA wohl nicht gefunden zu hätten.
KI schenkt uns ersparte Zeit, heißt es – demnächst noch viel mehr, nämlich in der Arbeitslosigkeit, wie Walter sarkastisch fragte? Beide Experten wiegelten ab: KI spare Zeit und Ressourcen, nicht mehr und nicht weniger. Ob der gewerbliche Rechtsschutz am Ende sei, wenn KI eigenständig Erfindungen schaffe? Weit weg, aber gut möglich, so Bittner. Und wem gehört die Erfindung, die eine KI macht? Immer dem Menschen, so der Experte.
Wo liegen also die wahren Risiken im Zusammenhang mit KI? „In der deutschen Überregulierung“, so Bittner. „Wir verlieren den Anschluss!“. – „In der Asymmetrie“, so Brehm: Je größer ein Unternehmen sei und je mehr Geld es investieren könne, desto mehr könne es sich den Ausbau von KI-Einsatz leisten - und kleine und mittelständische Unternehmen noch weiter abhängen.
Und wo liegen die Chancen? Natürlich im Potential für Innovationen und neue Lösungen für alte Probleme, so Bittner. Im Einsatz für die breite Masse, so Brehm, wo sie ja längst allgegenwärtig sei (fragen Sie nur mal Ihr Smartphone!).
Neues aus dem inneren Zirkel der Gesetzgebung
Ein fester Bestandteil jedes DPMAnutzerforums ist der Austausch mit Dr. Christian Wichard vom Bundesministerium der Justiz (Leiter der Unterabteilung III B), dem das DPMA zugeordnet ist. Hier erfahren die Gäste immer aus erster Hand, was gerade in der nationalen und europäischen Rechtsprechung im Hinblick auf den gewerblichen Rechtsschutz im Gange ist.
Zum Beispiel der aktuelle Stand des geplanten EU-Patentpakets: Die laufende Arbeit daran binde viele Ressourcen, so Wichard; vieles müsse noch erarbeitet und umgesetzt werden. Das Paket sieht unter anderem Regelungsvorschläge zu EU-weiten Zwangslizenzen vor, die Wichard skeptisch sieht („hoch politisch; wenn Zwangslizenzen auch nur in der Debatte im Raum stehen, sind sie oft schon Druckmittel genug“). Die Pläne zu den Standard-Essenziellen Patenten (SEPs) seien dagegen aus seiner Sicht grundsätzlich gut, aber es gebe noch Verbesserungsbedarf. Bei den Ergänzenden Schutzzertifikaten (SPCs) sei die Lage besonders kompliziert; die Pharmaindustrie warte, Deutschland dränge auf Fortschritte.
Im Hinblick auf die Designrechtsreform und die Umsetzung der EU-Designrichtlinie gebe es positive Entwicklungen, so Wichard. Sie werde nun dem technologischen Fortschritt angepasst. Künftig werden etwa auch animiertes Design oder grafische Benutzeroberflächen schutzfähig. Gleichzeitig könne man damit auf neue Verbreitungsformen wie 3D-Drucker angemessen reagieren.
Die Reform des Rechts geographischer Angaben steht an. Künftig sollen auch regionale Handwerksprodukte wie Holzschnitzer oder Glasbläser unter diesen Schutz fallen können, was auch als Strukturförderungsmaßnahme zu verstehen sei. Hier gelte es aber noch Zuständigkeiten zu klären.
Walter fragte Wichard noch nach einer ganzen Reihe von Themen: Gerät das nationale Patent ins Hintertreffen gegenüber dem Einheitspatent? Das Einheitspatent sei eine Erfolgsgeschichte, so Wichard, ebenso das Gerichtssystem. Aber es sei nun mal auch teurer, und das deutsche Patent „hat seine Vorteile“.
Sollte man den Patentschutz nicht doch für Software erweitern? Eher nicht, so Wichard; es soll weiterhin nur der technische Effekt in Betrachtung kommen. Die Öffnung des Gebrauchsmusters für Verfahren sei aber „durchaus ein Thema“.
Ist das Patentsystem einfach unpraktisch für Start-ups, weil sie sehr wenig anmelden? Nein, findet Wichard, aber es gibt offenbar großen Bedarf für Information und Aufklärung. Auf den Vorstoß des BDI zu einer nationalen IP-Strategie angesprochen, begrüßt er dies im Prinzip, spricht aber von einem längeren Prozess, bei dem alle Beteiligten eingebunden werden müssten. Die Einführung einer Neuheitsschonfrist nach US-Vorbild lehnt Wichard mit Verweis auf juristische Unsicherheiten ab („fluide Phase“).
Sollten die Patentgebühren zugunsten des Mittelstandes gesenkt werden, wie es etwa die USA mit ihrem „small entity claim“ vormachen? Eher nicht, so Wichard, aber das werde geprüft: Die Gebühren des DPMA seien ja ohnehin moderat und lange nicht mehr erhöht worden.
Die „größten Baustellen“, also die wichtigsten Herausforderungen für die Rechtsentwicklung rund um IP, sind laut Wichard natürlich Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Globalisierung. Besonders beim Thema KI und Urheberrecht steige der Druck, Transparenzanforderungen festzulegen sowie einen Lizenzmarkt und Nutzungsentgelte für Trainingsdaten aufzubauen.
EUIPO setzt auf Mediation
Sven Stürmann stellte das Mediationszentrum des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vor. Stürmann ist Präsident der Beschwerdekammern des EUIPO und selbst Mediator. Die Leidenschaft für diese Form der Streitbeilegung merkte man seinem lebendigen Vortrag an.
Auseinandersetzungen um geistiges Eigentum sind sehr häufig. „Konflikte können durchaus innovationsfördernd sein“, so Stürmann - Stichwort: kreative Reibung. Aber sie können auch sehr viel Geld und Zeit kosten, wenn sie vor Gericht enden. Da sollte man ruhig nach Alternativen suchen: Stürmann stellte die freiwillige, vertrauliche Streitbeilegung für IP-Konflikte vor, die das EUIPO anbietet.
Die alternative Streitbeilegung (ADR) ist laut Stürmann sehr erfolgreich: 70 Prozent Einigungsquote, 80 Prozent Benutzerzufriedenheit. Das Mediationszentrum hat 2024 sein erstes vollständiges Betriebsjahr abgeschlossen. Im Vergleich zu 2023 lasse sich schon ein klarer Aufwärtstrend beobachten, was hauptsächlich auf die Erweiterung der Mediation auf Löschungsverfahren zurückzuführen sei.
Verhandlungsproblem wie Sprachbarrieren und kulturelle Unterschiede ließen sich heute immer besser lösen, so Stürmann. Deutsche Nutzer spielen eine sehr wichtige Rolle in der EUIPO-Mediation – sie sind mit 22 Prozent die häufigsten Mediationskunden. Deutsch ist auch nach Englisch die zweithäufigste Mediationssprache. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, hat das EUIPO die Kapazität für deutschsprachige Mediation jüngst verdoppelt. „Dies unterstreicht unser Engagement, deutsche Parteien und Nutzer weiterhin aktiv zu begleiten, damit sie Mediation als zusätzliches Streitbeilegungsinstrument nutzen können – insbesondere, während wir die Mediation auf alle inter-partes-Verfahren des Amts ausweiten.“
Als weitere Verbesserung wird die Verkürzung der Mediationsdauer auf maximal drei Monate ab Ernennung des Mediators angestrebt. Dazu werden u.a. kürzere Fristen für wesentliche Schritte eingeführt.
Digital Services Act: Zahnloser Papiertiger?
Seit einem Jahr gilt das „Gesetz über digitale Dienste“, besser bekannt als Digital Services Act (DSA), ein einheitliches gemeinsames Regelwerk für die gesamte Europäische Union. Es betrifft alle digitalen Dienste, die den Verbraucherinnen und Verbrauchern Waren, Dienstleistungen oder Inhalte vermitteln. Nutzerinnen und Nutzer soll es besser schützen, Unternehmen Rechtssicherheit bieten. Aber funktioniert es auch?
Die Podiumsdiskussion „Digital Services Act – Auswirkungen auf die gewerblichen Schutzrechte“ widmete sich dieser Frage. Eine Kurzzusammenfassung der Antworten: Es funktioniert so lala. Zwar sei alles transparenter geworden, aber bedeutende Verbesserungen stellten die Teilnehmer trotz ihrer unterschiedlichen Perspektiven noch nicht fest.
Sebastian Meyer (Schwanhäußer Industrie Holding GmbH & Co. KG) sprach gar von „viel Lärm um Nichts“. Sein Unternehmen, das besonders für die „Stabilo“-Textmarker bekannt ist, gehe weiterhin jährlich etwa 5-6000 Mal per „Notice and take down“ gegen illegale Nachahmungsprodukte auf Online-Plattformen vor. Angesichts der hohen kriminellen Energie, mit der man konfrontiert sei, habe sich kaum etwas verbessert. Vor allem dem Mittelstand habe der DSA kaum geholfen, so Meyer.
Anwältin Dr. Hannah Bug (Kanzlei Gleiss Lutz) hielt fest, dass es zwar viele neue Pflichten für die Betreiber von Online-Plattformen gebe. Die IP-Inhaber profitierten aber nicht sehr viel, weil die Praxis der Rechtsdurchsetzung eher gleich geblieben sei.
Auch Dr. Deniz Erdem von der Bundesnetzagentur betonte vor allem die gestiegenen Pflichten für die Plattformbetreiber, etwa im Hinblick auf Beschwerdemanagement und Streitbeilegung. Erdem verwies auf die koordinierende Rolle seiner Behörde: Sie werde bei Beschwerden oder Hinweisen aktiv; eine proaktive Überwachung der Anbieter könne sie momentan nicht leisten: „Der Markt ist ein Ozean!“
„VLOPs“ – very large online platforms – nennt man die großen Shops im Internet. Zalando SE, für das Dr. Stefan Naumann arbeitet, ist zweifellos ein „VLOP“, wenngleich auch nicht einer der größten. Man werde jetzt zwar auditiert und müsse etwa auf Dokumentation und Reporting deutlich mehr achten als zuvor, aber ansonsten habe sich für sein Unternehmen wenig geändert, da man schon zuvor viel Wert auf Korrektheit gelegt habe, so Naumann.
Fiona Burg vom DPMA betonte, wie wichtig Eintragung und Schutz von geistigem Eigentum bei all dem weiterhin bleibe. Alle Diskutanten waren sich einig, dass für eine abschließende Beurteilung des DSA noch mehr Zeit vergehen müsse, um weitere Erfahrungen zu sammeln.
Marken in der virtuellen Welt

Dr. Senta Bingener (DPMA)
Vor etwa 20 Jahren war es ein ganz großes Ding: das Online-Spiel „Second life“. In diesem ersten virtuellen Parallel-Universum spielten schon damals Marken und Kommerz eine gewisse Rolle. Aber dann geriet die Nebenwelt für Jahre aus dem Fokus des Interesses.
Das hat sich jetzt (dank des technologischen Fortschritts; Stichwort VR-Brille etc.) gründlich geändert, wie DPMA-Mitarbeiterin Dr. Senta Bingener in ihrem Vortrag „Marken im Metaverse – Ein Ausblick“ ausführlich darlegte. Das Metaverse ist wieder da – nicht als pixeliges Paralleluniversum, sondern als Verschmelzung realer und erweiterter Realität im „Web 3.0“. Und mit ihm eine ganz eigene Ökonomie rund um Blockchains, Kryptowährungen und Non Fungible Tokens, die mit der „realen“ Ökonomie eng verzahnt ist.
In dieser virtuellen, interaktiven Umgebung, wo User durch Avatare arbeiten, spielen und handeln, hat sich eine eigene Metaverse-Ökonomie gebildet. Und die hat es in sich: Prognosen sehen ein derzeitiges Marktpotential von 103,5 Milliarden Dollar und fast 40 Prozent aller Menschen als Nutzer bis 2030.
Da liegt es auf der Hand, dass jetzt der Markenschutz im Metaverse ein großes Thema ist. Das betrifft etwa virtuelle Güter, also digitale, im Metaverse verwendbare Produkte wie Kleidung oder Haushaltsgegenstände für die Avatare. Angesichts der Entwicklung des Metaverse haben besonders größere „Player“ aus Lifestyle und Luxusgütern enormes Interesse daran, ihren Markenschutz auf diese virtuellen Güter zu erweitern.
Bingener zeigte in ihrem Vortrag detailliert auf, welche Klassifikationen in Frage kommen. Derzeit sind es noch vor allem große und „hippe“ Unternehmen, die hier tätig werden. Aber angesichts der rasant steigenden wirtschaftlichen, technischen und gesellschaftlichen Entwicklung des Metaverse müssen sich künftig wohl viele Unternehmen ihre individuellen Gedanken machen über einen möglichen ökonomischen Mehrwert der Bespielung des virtuellen Raums.
Nächstes Jahr!
Eva Schewior und ihre Vizepräsidentin Dr. Maria Skottke-Klein ließen es sich zum Abschluss der ersten Tages nicht nehmen, den zahlreichen Gästen und Beitragenden zu danken, wiesen auf die Online-„Beiträge aus dem DPMA“ am Folgetag hin und verkündeten schon den Termin des nächsten DPMAnutzerforums: 17. und 18. März 2026.
Schnell eintragen, bitte!
- Alle Präsentationen, die am 26. März zu den "Beiträgen aus dem DPMA" als Livestream zu sehen waren, finden Sie bei den Unterlagen des DPMAnutzerforums 2025.
Bilder: DPMA
Stand: 21.05.2025
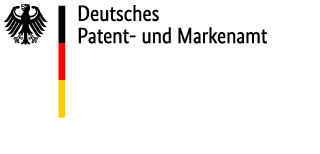











Wir schützen nicht nur Innovationen.
Soziale Medien