Inhalt
Geistiges Eigentum in der digitalen Welt

Von Online-Shops und Metaverse bis Apps und KI: So schützen Sie Ihre Ideen, Innovationen und Inhalte
Broschüre
Geistiges Eigentum in der digitalen Welt ist ein facettenreiches Thema: vom Lernen mit Apps auf dem Smartphone bis zum Verkauf von Produkten in Online-Shops und im Metaverse, vom Schutz von Geschäftsgeheimnissen bis zum 3D-Druck. Und Künstliche Intelligenz hat alles noch einmal weitergedreht.
Sie möchten einen Überblick gewinnen, wo geistiges Eigentum in der digitalen Welt relevant ist? Und wie Sie Ihre Ideen, Innovationen und Inhalte schützen können? Diesen Überblick bieten wir mit unserer Broschüre und auf diesen Seiten.
Von Fotos, Online-Streams und künstlicher Intelligenz – Urheberrecht im Wandel
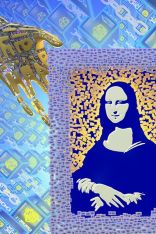
Texte, Fotos, Musik oder Filme: Durch die Digitalisierung sind neue Nutzungsmöglichkeiten urheberrechtlich geschützter Werke entstanden. Das gilt aber auch für die Art und Weise, wie Rechte an diesen Werken verletzt werden können.
Neue Fragen stellen sich im Zusammenhang mit sogenannter generativer künstlicher Intelligenz: Wer ist Urheberin oder Urheber, wenn das "Werk" mit einer KI erstellt wurde?
Hier gilt: Ein von einer KI erstellter Inhalt, sogenannter "Output", ist nicht urheberrechtlich geschützt, wenn er vollständig durch eine KI erzeugt wurde. Schwieriger ist der Fall zu beurteilen, wenn die KI lediglich als Werkzeug eingesetzt wird. Hier kommt es auf den Einzelfall an.
Urheberrecht spielt auch bei der Nutzung des Outputs sowie beim Training von KI-Modellen eine Rolle.
KI-Verordnung und Urheberrecht:
Die KI-Verordnung regelt den Einsatz von Systemen künstlicher Intelligenz (KI-Systeme) in der Europäischen Union. Anbieter von generativen KI-Modellen müssen nach der KI-Verordnung eine Strategie zur Einhaltung des Urheberrechts der Union und Informationen zum Training ihrer KI veröffentlichen.
Ein ![]() Code of Conduct – ein freiwilliger Verhaltenskodex – hilft Anbietern von generativen KI-Modellen, die Pflichten aus der KI-Verordnung, insbesondere auch zum Urheberrecht, umzusetzen.
Code of Conduct – ein freiwilliger Verhaltenskodex – hilft Anbietern von generativen KI-Modellen, die Pflichten aus der KI-Verordnung, insbesondere auch zum Urheberrecht, umzusetzen.
Eine App patentieren?
Computerimplementierte Erfindungen
- Voraussetzungen der Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen/Software-Patenten
Ob ein kleines Unternehmen Termin- und Informationsdienste bereitstellt oder ein Start-Up innovative Lernmethoden, kreative Spielideen oder neue technische Lösungen anbietet: Hinter einer App kann eine Menge Erfindungsreichtum stecken.
Eine App kann grundsätzlich unter bestimmten Voraussetzungen patentiert werden: Als sogenannte computerimplementierte Erfindung (CII), wenn sie Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Der reine Quellcode oder Algorithmus einer App reicht für eine Patentierung also nicht aus, sondern entscheidend ist die technische Funktionalität zur Lösung eines technischen Problems.
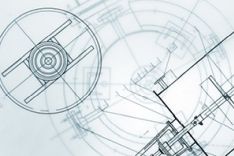
Entwicklerinnen und -Entwickler, deren App keine neue technische Lösung darstellt, sondern die beispielsweise ihre bestehenden Angebote um digitale Dienste erweitern wollen, werden vor allem im Markenschutz eine Form finden, ihre mobile App-Idee zu schützen.
Die konkrete grafische Gestaltung der Benutzeroberfläche oder von visuellen Wegweisern kann auch durch das Design schutzfähig sein. Auch sind Apps als Software in der Regel urheberrechtlich geschützt gemäß § 69a UrhG.
Übrigens: Wird ein Computerprogramm von einem Arbeitnehmer in Wahrnehmung seiner Aufgaben oder nach den Anweisungen seines Arbeitgebers geschaffen, dann ist der Arbeitnehmer zwar Urheber, aber gemäß § 69b Abs. 1 UrhG liegen die Nutzungsrechte beim Arbeitgeber. Für freie Mitarbeiter existiert keine solche gesetzliche Regelung – hier sollte sich der Auftraggeber vertraglich die Nutzung einräumen lassen.
Plattformhaftung

Eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von rechtsverletzenden Inhalten spielen Online-Plattformen: Wenn ein User etwa Produkte verkauft, die fremde Markenrechte verletzen oder ein Musikvideo hochlädt, dessen Rechte er nicht hat. Um die Verletzungen zu stoppen, kann man sich an den User wenden. Man kann sich aber auch an die Online-Plattform wenden.
Verletzungen Ihrer geistigen Eigentumsrechte online melden:
Anbieter von Hostingdiensten, insbesondere von Online-Plattformen, sind verpflichtet, ein Meldeverfahren, mit dem rechtswidrige Inhalte (etwa Verstöße gegen die Rechte geistigen Eigentums) gemeldet werden können, anzubieten, diese Meldungen zu prüfen und bei Vorliegen einer Verletzung zu handeln. Übrigens: Meldungen können nicht nur durch Rechteinhaberinnen und -inhaber erfolgen, sondern insbesondere auch durch sogenannte vertrauenswürdige Hinweisgeber (englisch trusted flaggers). Ihre Meldungen werden prioritär behandelt.
Vertrauenswürdige Hinweisgeber im Rahmen des Digital Services Act
In Deutschland sind im Bereich des geistigen Eigentums der ![]() Bundesverband Verbraucherzentrale und der
Bundesverband Verbraucherzentrale und der ![]() Bundesverband Onlinehandel vertrauenswürdige Hinweisgeber.
Bundesverband Onlinehandel vertrauenswürdige Hinweisgeber.
Haftung von Anbietern von Hosting-Diensten (darunter Online-Plattformen):
Nicht nur der User, der ein geistiges Eigentumsrecht verletzt, haftet. Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch der Anbieter etwa auf Unterlassung oder Schadensersatz haften: Grundsätzlich haftet der Anbieter beispielsweise einer Online-Plattform nicht für die rechtsverletzenden Inhalte seiner Nutzer – es sei denn, er hat hiervon Kenntnis. Wenn der Anbieter etwa aufgrund einer Meldung ohne eingehende rechtliche Prüfung feststellen kann, dass ein Inhalt fremdes geistiges Eigentum verletzt, dann muss er zügig den Zugang zu den rechtsverletzenden Inhalten sperren oder entfernen. Wird der Anbieter nicht oder zu spät tätig, kann er zivilrechtlich haften.
Sperrung einer Webseite (DNS-Sperre):
Es besteht die Möglichkeit, DNS-Sperren gegen strukturell urheberrechtsverletzende Websites, wie zum Beispiel illegale Streaming-Seiten, zu verhängen. Seit Juli 2025 prüfen Gerichte (und nicht mehr die Bundesnetzagentur) jeden Einzelfall vor der Aktivierung solcher Sperren. Entscheidet das Gericht, dass eine strukturell rechtsverletzende Website gesperrt werden muss, teilt der betroffene Rechteinhaber dies der Clearingstelle für Urheberrecht im Internet (CUII) mit. Sodann setzen die in der CUII organisierten Internetzugangsanbieter die DNS-Sperre um. Bei einer DNS-Sperre wird der Zugriff auf eine Domain blockiert, indem der DNS-Server keine oder eine falsche IP-Adresse liefert.
Bild 1: Gettyimages/piranka, Bild 2: links oben/unten: iStock.com/kyoshino/Andrei Naumenka, Mitte oben/unten: iStock.com_Shidlovski/adventtr, rechts oben/unten: iStock.com/Olivier Le Moal/deepblue4you, Bild 2: Gettyimages/TIM VERNON/SCIENCE PHOTO LIBRARY, Bild 3: Gettyimages/teekid, Bild 4: Gettyimages/Sandipkumar_Patel
Stand: 10.12.2025
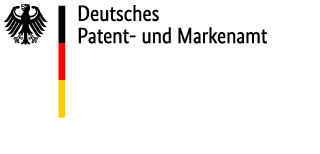
Wir schützen nicht nur Innovationen.
Soziale Medien