Inhalt
DPMAimpuls 2025

DPMA-Präsidentin Eva Schewior
Wissen nutzen, Innovationen schützen, Wirtschaft stärken
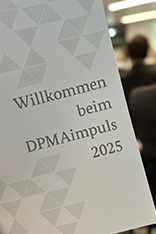
Wie lassen sich gewerbliche Schutzrechte strategisch noch besser nutzbar machen, um unseren Wirtschaftsstandort zu stärken? Zu dieser Frage diskutierten 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wirtschaft, Wissenschaft und Justiz bei DPMAimpuls in München. Der Titel des Dialogformats: „IP-Kompetenz im Innovationsnetz Deutschland“.
Breiter Austausch zur Rolle des geistigen Eigentums (Intellectual Property, IP) im Innovationssystem: Wie können wir unseren Wirtschaftsstandort durch den strategischen Einsatz von IP stärken? Wie können wir Innovationen aus dem Wissenschaftsbetrieb mit Hilfe gewerblicher Schutzrechen noch besser in handelbare Produkte, tragfähige Geschäftsmodelle und damit Wirtschaftswachstum transferieren? Diese Kernfragen bearbeiteten am vergangenen Freitag (14. November) rund 50 Expertinnen und Experten aus Industrieunternehmen unterschiedlicher Branchen, aus der Wissenschaft, aus Verbänden und Organisationen, aus der Richterschaft und aus der Patentanwaltschaft mit Impulsvorträgen und engagierten Diskussionen beim Dialogformat DPMAimpuls in München.
„ Der Schutz von Innovationen ist ein entscheidender Faktor für die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und deshalb ein Schlüsselthema für unseren Industriestandort“, sagte DPMA-Präsidentin Eva Schewior zum Auftakt der Veranstaltung am Freitag im Dienstgebäude im Münchner Werksviertel. Die Frage sei, was man gemeinsam in puncto IP-Kompetenz im Innovationssystem Deutschlands noch besser machen könne. Aus vielen verschiedenen Perspektiven auf die gewerblichen Schutzrechte zu blicken, verleihe der Veranstaltung einen ganz eigenen Wert.
Ein Blick in die Zahlen

Lukas Littmann
„Deutschland muss wieder innovativer werden.“ Dieser Satz und Varianten davon fielen derzeit besonders häufig, so Lukas Littmann, Referatsleiter für Innovationspolitik bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). In seiner Standortbestimmung zeigte er auf, dass die Bundesrepublik im Jahr 2024 rund 3,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Entwicklung investierte – während die Rate in Südkorea bei fünf Prozent lag, in Israel bei 6,3 Prozent. Nach DIHK-Erhebungen wolle derzeit nur jedes dritte Unternehmen in Produktinnovationen investieren; und jedes dritte Unternehmen ziehe in Erwägung, die Zukunftsarbeit ins Ausland zu verlagern. Die aktuellen Herausforderungen für die deutsche Industrie fasste Littmann mit diesen Schlagworten zusammen: Demographie, Digitalisierung, Dekarbonisierung, Diversifizierung und Disruption.
Dekarbonisierung als Chance

DPMA-Vizepräsidentin Dr. Maria Skottke-Klein
Littmann ging auf die ![]() Hightech-Agenda der Bundesregierung ein und unterstrich die Notwendigkeit, Innovationen rascher in die Praxis zu bringen, um daraus Wirtschaftswachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand zu ermöglichen. Mehr Reallabore für Zukunftstechnologien und mehr Wagniskapital seien dafür ebenso vonnöten wie intensiverer Transfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft. In der Diskussion zu Littmanns Vortrag unterstrichen mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Notwendigkeit, die Hightech-Agenda mit dem Schutz technologischer Innovationen zu verknüpfen, und sie betonten den dringenden Bedarf einer nationalen IP-Strategie. Für geistiges Eigentum als Hebel zu werben, stehe, so Littmann, beim DIHK beispielsweise bei den monatlichen Treffen mit den Innovationsberatern aus den 79 Kammerregionen an.
Hightech-Agenda der Bundesregierung ein und unterstrich die Notwendigkeit, Innovationen rascher in die Praxis zu bringen, um daraus Wirtschaftswachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand zu ermöglichen. Mehr Reallabore für Zukunftstechnologien und mehr Wagniskapital seien dafür ebenso vonnöten wie intensiverer Transfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft. In der Diskussion zu Littmanns Vortrag unterstrichen mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Notwendigkeit, die Hightech-Agenda mit dem Schutz technologischer Innovationen zu verknüpfen, und sie betonten den dringenden Bedarf einer nationalen IP-Strategie. Für geistiges Eigentum als Hebel zu werben, stehe, so Littmann, beim DIHK beispielsweise bei den monatlichen Treffen mit den Innovationsberatern aus den 79 Kammerregionen an.
Dekarbonisierung als Chance für die Wirtschaft – dafür warb in der Diskussion Detlef von Ahsen, Präsident des Bundesverbands Deutscher Patentanwälte. Der gebürtige Bremer erinnerte an die Transformation im Werftenbau: Kompetenzen aus dieser Branche konnten genutzt werden, um Luftentschwefelungsanlagen zu fertigen. Aus Sicht von Ahsens beispielhaft dafür, wie der Umweltschutz als gesellschaftliche Herausforderung technologische Innovationen und damit wirtschaftliches Wachstum anstößt.
Für stärkere Transferstrategie in der Wissenschaft

Dr. Bernadett Simon
Im Wissenschaftsbetrieb finde der Wissens- und Technologietransfer noch zu wenig Beachtung, konstatierte Dr. Bernadett Simon, Leiterin der Abteilung Transfer im Dezernat Forschungsmanagement und Transfer an der Universität Köln und Vorstandsmitglied der Transfer Allianz e.V. Wissenschaftliche Veröffentlichungen hätten oft Priorität vor Schutzrechtsanmeldungen oder gar unternehmerischem Denken. Die Studie ![]() Transfer 1000 des Fraunhofer Instituts zeige allerdings auf, dass 79 Prozent der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Meinung sind, dass Wissenschaft gesellschaftliche Verantwortung übernehmen sollte. 85 Prozent der 1000 Befragten sehen die eigene Forschung als gesellschaftlich relevant an. „Im Vergleich dazu gibt es nur relativ wenige Patente und Ausgründungen aus deutschen Wissenschaftseinrichtungen“, sagte Bernadett Simon. Mangelnde Ressourcen in den Wissenschaftsorganisationen und mangelnde Karriereanreize in Verbindung mit IP machte sie als Gründe aus. Transfer sei zwar als Aufgabe in den Hochschulgesetzen der meisten deutschen Bundesländer verankert, allerdings hätten nur 58 Prozent aller Wissenschaftseinrichtungen eine Transferstrategie.
Transfer 1000 des Fraunhofer Instituts zeige allerdings auf, dass 79 Prozent der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Meinung sind, dass Wissenschaft gesellschaftliche Verantwortung übernehmen sollte. 85 Prozent der 1000 Befragten sehen die eigene Forschung als gesellschaftlich relevant an. „Im Vergleich dazu gibt es nur relativ wenige Patente und Ausgründungen aus deutschen Wissenschaftseinrichtungen“, sagte Bernadett Simon. Mangelnde Ressourcen in den Wissenschaftsorganisationen und mangelnde Karriereanreize in Verbindung mit IP machte sie als Gründe aus. Transfer sei zwar als Aufgabe in den Hochschulgesetzen der meisten deutschen Bundesländer verankert, allerdings hätten nur 58 Prozent aller Wissenschaftseinrichtungen eine Transferstrategie.
Von Briten und Belgiern lernen

Dr. Bernd Läßiger, Leiter der Hauptabteilung 1 beim DPMA
Als vorbildliche Modelle aus anderen Ländern führte Simon an: Das Research Excellence Framework (deutsch etwa: System zur Bewertung von Forschungswirkung) aus Großbritannien, das Förderung eng an den Transfer von Wissenschaftsergebnissen koppelt. Das Flämische Institut für Biotechnologie, das 15 Prozent seines Jahresbudgets über Lizenzen, Start-ups und Kooperationen erwirtschafte. Die Belgier betrieben so aktives „Business Development“, also aktive Geschäftsmodellentwicklung direkt aus dem Wissenschaftsbetrieb heraus.
Wie kann die Transferquote hierzulande gesteigert werden? „Transfer braucht Expertenwissen und nachhaltige Unterstützung“, so Bernadett Simon. Konkret nannte sie unter anderem das Verstetigen entsprechender personeller Ressourcen an den Hochschulen und eine Verständigung darüber, was die Profession von Transferexperten überhaupt ausmache. Transfer Allianz e.V. bringe sich dabei beispielsweise über einen Bund-Länder-Dialog ein und habe zusammen mit der SPRIN-D(Bundesagentur für Sprunginnovationen), mit dem Stifterverband und weiteren Organisationen Grundsätze für eine nationale IP-Strategie erarbeitet.
Konstruktive Kontroverse zur Forschungslandschaft

Dr. Manuel Neetz
Über die Aufgabenverteilung in Forschung und Anwendung diskutierten die Teilnehmenden im Anschluss an den Impuls von Bernadett Simon kontrovers. Während Vertreter der Fraunhofer Gesellschaft die Grundlagenforschung bei Max-Planck-Gesellschaft und Universitäten sahen, die Anwendungsforschung und den Transfer bei Fraunhofer und Helmholtz Instituten, unterstrich Bernadett Simon: „Exzellenz in Forschung und Transfer schließen sich nicht gegenseitig aus.“
Dass IP der Dreh- und Angelpunkt von Kollaborationen zwischen industriellen und akademischen Partnern ist, arbeitete Dr. Manuel Neetz, Abteilungsleiter IP Diagnostic Imaging, Siemens Healthineers, in seinem Vortrag heraus. Eigentums- und Nutzungsrechte, Entwicklungs- und Vermarktungslizenzen, das Recht über die Innovation zu publizieren: Neetz stellte unterschiedliche Modelle für Kooperationen in Theorie und Praxis vor. Ein besonders innovatives und kostengünstiges System zur Magnetresonanztomographie (MRT), das mit dem Deutschen Zukunftspreis 2023 ausgezeichnet wurde, ging aus einer Kooperation von Siemens Healthineers AG mit dem Universitätsklinikum Erlangen hervor.
Über Patentdurchsetzung in Deutschland sprach bei DPMAimpuls Dr. Oliver Schön, Vorsitzender Richter am Landgericht München I. Er zeigte auf, dass es in den Bereichen Mobilfunk, Streaming-Dienste und Automobil derzeit besonders intensiv um die Wertermittlung von Lizenzen gehe.
Mit geistigem Eigentum Schule machen

Dr. Oliver Schön
Mehr Wissen, mehr Aufmerksamkeit, mehr Verständnis und mehr Wertschätzung für geistiges Eigentum und gewerbliche Schutzrechte erreichen: So splittete DPMA-Experte Roger Hildebrandt die Aufgaben auf, die aus dem gesetzlichen Auftrag zu Information und Bewusstseinsbildung nach §26a Patentgesetz erwachsen. Wie sieht das in der Praxis aus? Hildebrandts Beispiele reichten von passgenauen Inhalten für Vertretungsstunden in Schulen und Fortbildungen zu Entrepreneurship für Lehrkräfte über Netzwerkarbeit mit Hochschulen bis hin zu Workshops und Tagungen mit Akteuren im IP-System. Aktuell nutzen auf europäischer Ebene laut Studien nur knapp zehn Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) gewerbliche Schutzrechte – und das, obwohl auch kleinere Unternehmen viele Vorteile daraus ziehen, wie Thomas Ulrich von der BSH Hausgeräte GmbH in der Diskussion schilderte: Er höre aus Start-Ups immer wieder, dass sie leichter an Geld von Investoren gelangen, wenn sie Patente vorweisen können.
Nächster DPMAimpuls am 13. Oktober 2026

„IP-Kompetenz im Innovationsnetz Deutschland“: Bei DPMAimpuls wurde dazu perspektivenreich, intensiv und teils auch kontrovers diskutiert. Einig waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darüber, wie wertvoll der konzentrierte Informations- und Meinungsaustausch bei dem Dialogformat ist. Klare inhaltliche Impulse, viel Zeit und Raum für Diskussionen im Plenum und für Einzel- oder Gruppengespräche über den ganzen Tag hinweg. Als Kalendereintrag konnten die Gäste aus München direkt mitnehmen: Am 13. Oktober 2026 findet die vierte Ausgabe von DPMAimpuls statt.
Bilder: DPMA
Stand: 09.02.2026
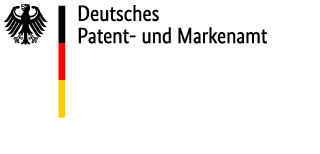
Wir schützen nicht nur Innovationen.
Soziale Medien